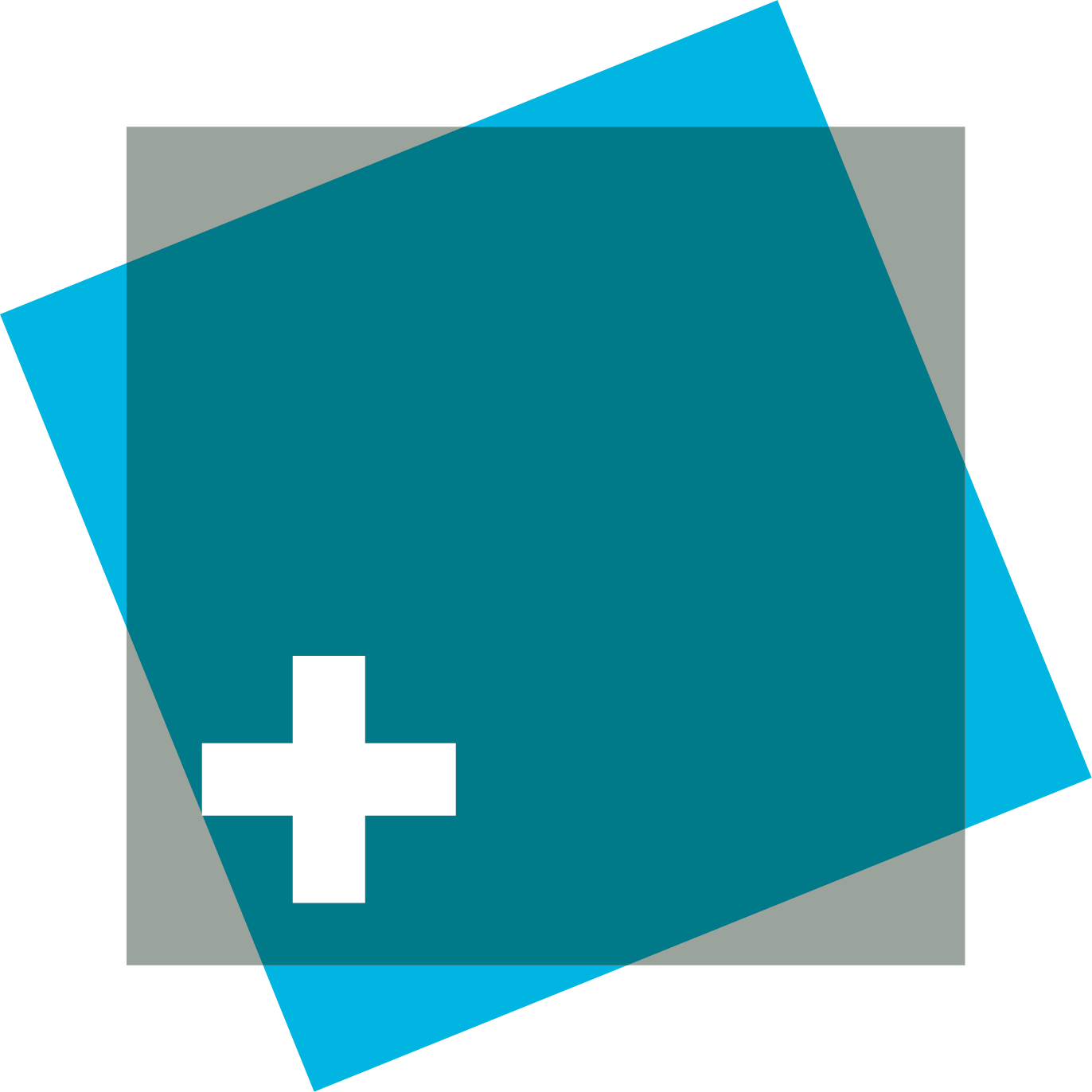Entscheidungsfindung unter Veränderungsdruck Wie Unternehmen schnell zu guten Entscheidungen gelangen
Irene Willi Kägi
Wollen Unternehmen und Organisationen wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie immer wieder Entscheidungen fällen: von der Wahl der passenden Mitarbeitenden und der optimalen Verteilung von Aufgaben bis hin zur Anpassung der Strategie und Neugestaltung von Produkten oder Dienstleistungen. Stetiger Veränderungsdruck und steigende Komplexität stellen Unternehmensleitung, Führungskräfte und Teams vor die Frage: Wie können wir möglichst schnell zu guten Entscheidungen gelangen, besonders wenn kontroverse Meinungen vorherrschen? Und: Wer hat welche Entscheidungskompetenz?
Drei Arten von Entscheidungen
In Unternehmen existieren hauptsächlich drei verschiedene Arten von Entscheidungen: Operative Entscheidungen betreffen Fragestellungen, die in der täglichen Arbeit von einzelnen Mitarbeitenden oder Teams entstehen. Schnelle und fundierte Lösungen ergeben sich dann, wenn die Personen die Entscheidung treffen, die über das beste Wissen verfügen – also die Fachexperten und -expertinnen in den Teams. Und das ist in der heutigen Zeit oft nicht die Führungskraft. Bei strukturellen Entscheidungen geht es beispielsweise um die Zusammensetzung eines Teams oder darum, welche Hilfsmittel und Arbeitsmethoden eingesetzt werden. Strategische Entscheidungen betreffen das gesamte Unternehmen oder spezifische Geschäftsbereiche: In welche Richtung steuert das Unternehmen? Auf welche Geschäftsfelder, Regionen, Dienstleitungen oder Produkte sollen wir uns fokussieren? Strukturelle oder strategische Entscheidungen werden in der Regel auf einer übergeordneten Ebene bzw. auf der Führungsebene und oft von mehreren Personen getroffen.
Agile Organisationen machen es vor: von der Hierarchie zur Partizipation
In Zeiten geforderter Agilität verabschieden sich Organisationen zunehmend von dem Grundsatz, dass alle wichtigen Entscheidungen "oben" getroffen werden müssen. Der hierarchische Entscheidungsansatz ist nämlich oft zu langsam und zu weit weg vom Markt und den Mitarbeitenden entfernt. In agilen, holokratisch organisierten Unternehmen nehmen Führungsperson eher die Rolle eines Coaches ein, statt alles top-down zu entscheiden. Dass Selbstorganisation und Selbstverantwortung hier einen grossen Stellenwert haben, kommt nicht von ungefähr, denn diese Prinzipien sollen die Produktivität und Effektivität erhöhen.
Daily Stand-up und Dot Voting: schnell, pragmatisch und mehrheitsfähig
Zu den Instrumenten der operativen Entscheidungsfindung gehören in agilen Organisationen beispielsweise das «Kanban Board» sowie das tägliche 5- bis 15-minütige klar strukturierte «Stand-up Meeting», das im Stehen stattfindet. Dabei geht es darum, die zu erledigenden Arbeiten und die verfügbaren Kapazitäten ideal zu verteilen. Die Visualisierung der anstehenden und bereits erledigten Aufgaben sowie der gemeinsame Austausch unter Zeitdruck verbessern den Teamfokus und lassen Engpässe erkennen.
Auch bei strukturellen und strategischen Entscheidungen setzen agile Organisationen auf Partizipation statt auf Hierarchie. Die Mitarbeitenden können sich beteiligen, wenn sie von den Auswirkungen betroffen sind. Beispielsweise eignet sich das «Dot Voting» bzw. die Punktabfrage als Entscheidungsmethode, wenn zwischen vielen Optionen schnell eine Auswahl getroffen werden muss. Dabei leitet der bzw. die Moderator:in die Teilnehmenden an, jedes Thema (jede Lösungsoption), über das abgestimmt werden soll, jeweils auf einen Post-it-Zettel zu schreiben. Daraufhin werden diese für alle gut sichtbar auf einer Pinnwand oder einem Whiteboard angebracht. Alle Teilnehmenden erhalten die gleiche Anzahl von Klebepunkten, die sie auf die von ihnen favorisierten Optionen verteilen können. Als Faustregel gilt ein Verhältnis von 4:1 betreffend der zur Auswahl stehenden Optionen und der abzugebenden Stimmen. So erhalten die Teilnehmenden bei zwölf Themen jeweils drei Stimmen. Vor der Abstimmung ist darauf zu achten, dass ein einheitliches Verständnis über die Themen besteht. Nach der Punktevergabe werden die Stimmen ausgezählt. Am Ende resultiert eine priorisierte Liste von Lösungsoptionen.
Die Punktabfrage geht in der Regel schnell, hat aber den Nachteil, dass Minderheiten sich übergangen fühlen können und dann später die Entscheidung nicht mittragen. In grösseren Gruppen kann es auch passieren, dass die Mitglieder sich vom Abstimmungsverhalten anderer beeinflussen lassen (Frey, Schulz-Hardt & Stahlberg, 1996) und ihre Punkte auf die «beliebtesten» Zettel kleben. Ein solch unerwünschtes «Group-Think-Phänomen» lässt sich durch eine anonyme oder virtuelle Abstimmung mit digitalen Kollaborationstools wie Mural oder Miro vermeiden. Auch können im Vorfeld der Abstimmung ein bis zwei Personen beauftragt werden, bewusst Standpunkte zu hinterfragen. Aus der Forschung geht hervor (Schweiger, Sandberg & Ragan, 2017), dass diese Art der Intervention (auch bekannt als «Advocatus Diaboli») zu Entschlüssen von höherer Qualität führt.
Konsens: Die Suche nach der Einstimmigkeit
Der Konsens gilt in modernen Unternehmen vielerorts als die Königsdisziplin der Entscheidungsfindung. Dabei wird eine gemeinsame Position angestrebt, die von allen mitgetragen wird. Dieser Ansatz ist sinnvoll, wenn Positionen nicht zu weit voneinander entfernt sind und die Gruppenmitglieder die Grundformen der zwischenmenschlichen Kommunikation gut beherrschen (z.B. zuhören können). Eine Entscheidung wird erst getroffen, wenn alle dahinterstehen. Um in einer Gruppe einen Konsens erreichen zu können, müssen alle Mitglieder die Möglichkeit haben, ihre Position differenziert wiederzugeben.
Bei der “Gradients of Agreement”-Methode (“Abstufungen der Zustimmung”) werden die Teilnehmenden (beispielsweise per Handzeichen) gebeten, anhand einer vordefinierten Acht-Punkte-Skala zu bewerten, inwieweit sie eine bestimmte Entscheidung unterstützen oder befürworten:
- Vollständige Unterstützung: "Mir gefällt es."
- Befürwortung mit geringen Bedenken: "Ich finde es im Grossen und Ganzen gut."
- Zustimmung mit einigen Vorbehalten: "Ich kann damit leben."
- Enthaltung: "Ich habe keine Meinung."
- Beiseitetreten: "Ich mag das nicht, aber ich möchte die Gruppe nicht behindern.”
- Nicht einverstanden, aber bereit, sich der Mehrheit anzuschliessen: "Ich möchte, dass die anderen wissen, dass ich nicht einverstanden bin, aber ich werde die Entscheidung unterstützen."
- Nicht einverstanden, mit der Bitte, aus der Umsetzung herausgenommen zu werden: "Ich möchte die Gruppe nicht aufhalten, aber ich möchte auch nicht daran beteiligt sein."
- Es wird Einspruch gegen den Entscheid erhoben (Veto): “Ich kann den Vorschlag nicht unterstützen.”
In der Regel wird so lange diskutiert, bis es zu einer Entscheidung kommt, die von allen mitgetragen wird. Der Nachteil der Konsensfindung ist, dass sie oft lange dauert und nervenaufreibend sein kann. Zudem besteht das Risiko, dass der Konsens auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner beruht oder gar ein fauler Kompromiss ist, den niemand wirklich gut findet. Hinzu kommt: Sollte am Ende der Abstimmung nur ein einziges Gruppenmitglied Punkt 8 zustimmen, gibt es gar keinen Entscheid.
Konsent: Die beste Lösung setzt sich durch
Ein Konsensentscheid, mit dem alle einverstanden und davon begeistert sind, ist zwar erstrebenswert, in der Praxis aber oft unerreicht. Etwas realistischer stellt sich die Entscheidungsfindung nach dem Konsentverfahren dar: Eine Lösung wird dann gutgeheissen, wenn niemand ein Veto dagegen ausspricht. Anders formuliert heisst das: Die beste Lösung setzt sich durch.
Als Instrument eignet sich hier die «Integrative Decision Making»-Methode (Krogerus & Tschäppeler, 2023), wobei ein:e Moderator:in in folgenden Schritten durch den Entscheidungsfindungsprozess führt:
- Zuerst präsentiert eine Person oder einer Teilgruppe mit Expertenstatus das Problem, das es zu lösen gilt, vor dem versammelten Entscheidungsgremium.
- Dann präsentiert sie einen Lösungsvorschlag. Dieser muss noch nicht unbedingt bis ins Detail ausgefeilt sein, sondern lediglich eine valable Option darstellen.
- Nun können alle Fragen stellen, um den Vorschlag besser zu verstehen.
- Darauf folgt eine Diskussion, bei der jede:r einzelne sagt, was er bzw. sie davon hält.
- Jetzt können die Person oder Partei, welche den Lösungsvorschlag präsentiert hat, diesen nochmals besser erklären, präzisieren oder anpassen.
- Nun werden wieder alle Reaktionen angehört: Wer einen schwerwiegenden Einwand hat, muss ihn begründen. Als schwerwiegende Einwände gelten beispielsweise, wenn die Lösung die Organisation gefährdet oder andere schädliche Konsequenzen hat.
- Danach folgt die Integration: Der Moderator oder die Moderatorin fragt, wie der Vorschlag sich weiter anpassen lässt, sodass die Einwände aufgehoben sind und das anfangs formulierte Problem zumindest ansatzweise gelöst ist. Dabei wird nacheinander auf jeden einzelnen Einwand eingegangen. Am Ende ergibt sich eine Lösung, die vielleicht nicht hundertprozentig allen entspricht, aber gegen die es keine Einwände gibt.
Das Konsentverfahren bedeutet nicht, dass man einer Meinung ist, aber man verpflichtet sich trotzdem dazu, sich auf eine Lösung einzulassen, weil es zurzeit einfache keine bessere gibt. Weil bei der Entscheidungsfindung niemand übergangen werden darf, sorgt diese Methode zudem für eine relativ hohe Verbundenheit mit dem Resultat. Auch hier ist der Zeitaufwand – ähnlich wie beim Konsensverfahren – insbesondere bei grösseren Gruppen relativ hoch. Jedoch ist das zentrale Versprechen des Konsentverfahrens, dass daraus qualitativ bessere Entscheidungen als beim Konsens resultieren.
Fazit
Viele Unternehmen müssen sich heutzutage schnell an neue oder unvorhergesehene Situationen anpassen können – sei es indem sie ihre bereits vorhandenen Werkzeuge verändern oder neue und innovative Lösungen gestalten. Im Idealfall zählen bei der Lösungsfindung die Geschwindigkeit genauso wie die Qualität des Ergebnisses. Dazu gehören nicht nur die Akzeptanz von allen an der Lösung Beteiligten, sondern auch die Akzeptanz von allen von der Lösung Betroffenen. Bei grundsätzlichen Entscheidungen eignen sich allen voran partizipative Entscheidungsmethoden. Geht man davon aus, dass ein Konsens schwer möglich ist, dann kann der Konsent ein Ansatz sein, der immerhin zu einer Entscheidung führt. Bedenken und Widersprüche blockieren dabei die Entscheidungsfindung nicht, sondern werden in die Lösung eingearbeitet. Wichtig bleibt, deutlich zu machen, dass man einen Konsent anstrebt, nicht einen Konsens. Nicht zuletzt gilt es, einen sicheren Ort für einen respektvollen Austausch auf Augenhöhe zu schaffen an dem die Teilnehmenden sich offen äussern dürfen. Dabei darf sich Feedback nicht auf Personen, sondern nur auf Lösungsoptionen beziehen.
Quellen und weiterführende Informationen
Diehl, A. (2020). Konsent Entscheidungsfindung – Der agile Bruder des Konsens. Digitale Neuordnung Blog.
Frey, D., Schulz-Hardt, S., & Stahlberg, D. (1996). Information seeking among individuals and groups and possible consequences for decision making in business and politics. In E. H. Witte & J. H. Davis (Eds.), Understanding group behavior, Vol. 2. Small group processes and interpersonal relations (pp. 211–225). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Grimm, J. & Tokarski, K.O. (2022). Führen in agilen Organisationsstrukturen. In Resilienz durch Organisationsentwicklung (S. 225–251). Springer.
Kanning, U.P. (2021). Führen Diskussionen zu ausgewogeneren Entscheidungen? '15 Minuten Wirtschaftspsychologie'. YouTube.
Me&Company. Warum ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Abgerufen am 24.10.2023.
Mitson, R. Vier sofort einsetzbare Methoden für die Entscheidungsfindung. Sherpany. Abgerufen am 24.10.2023.
Nielsen Norman Group. (2019). Dot Voting: A Simple Decision-Making and Prioritizing Technique in UX.
Schweiger, D.M., Sandberg, W.R. & Ragan, J.W. (2017). Group Approaches for Improving Strategic Decision Making: A Comparative Analysis of Dialectical Inquiry, Devil's Advocacy, and Consensus. Academy of Management Journal, 29, (1).
Thurn, N. (2019). Wenn alle entscheiden: Konsens, Konsent oder Konsensieren im Unternehmen?
Diese Seite teilen
CAS FH in Organisationsentwicklung und -beratung
Certificate of Advanced Studies (CAS)