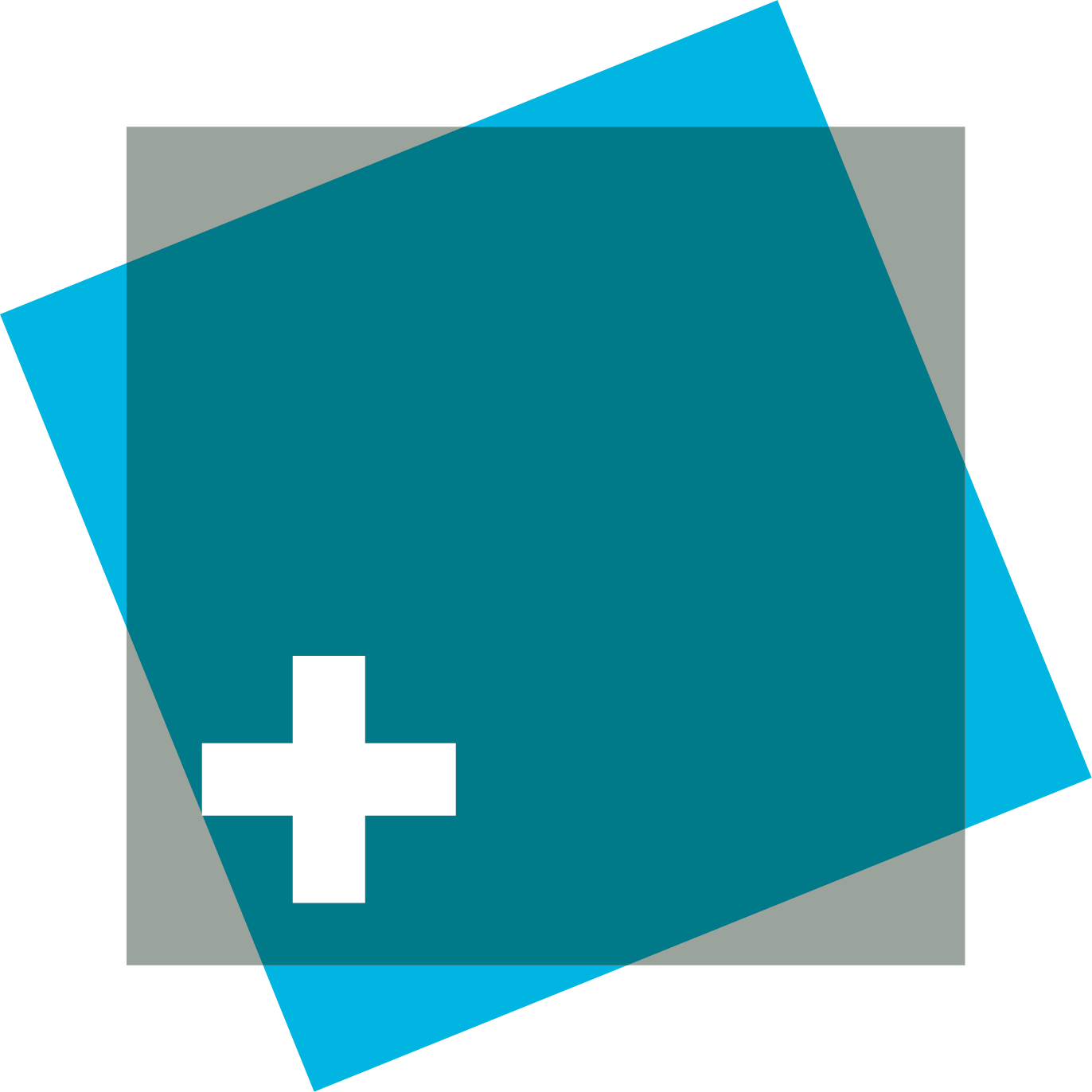Risikozuordnung in Verträgen und die COVID-19-Situation (1/2) Anwendungsbereich der clausula rebus sic stantibus
Prof. Dr. iur. RA Benjamin Enz
Der Gewinner unseres Blog-Schreibwettbewerbs zum Thema Recht steht fest: Der erste und zweite Preis gehen an Dr. iur. Benjamin Enz. Herzlichen Glückwunsch! Lesen Sie hier seinen ersten Beitrag, Teil 2 folgt im Januar auf unserem Kalaidos Blog.
Der vorliegende Blog-Beitrag basiert auf dem vom Autor verfassten Aufsatz «Risikozuordnung in Verträgen und die COVID-19-Situation: Teil 1, in: Jusletter vom 18. Mai 2020».
Einleitung
Die durch das Coronavirus verursachte Krankheit wurde von der WHO am 11. März 2020 offiziell zur Pandemie erklärt. Der Bundesrat erliess gestützt auf Art. 6 Abs. 2 lit. b und Art. 7 EpG diverse Corona-Verordnungen. Am 16. März 2020 rief der Bundesrat schliesslich die ausserordentliche Lage aus und verfügte mit Art. 5 ff. COVID-2-VO sehr einschneidende und weitreichende Massnahmen wie die Schliessung der Schulen, Barbetriebe, Restaurants und von zahlreichen weiteren Einrichtungen und Einschränkungen des grenzüberschreitenden Personenverkehrs, welche bis zum 26. April 2020 verlängert wurden.
Die Folgen dieser Pandemie werden sich noch über einen langen Zeitraum erstrecken. Jedenfalls ist klar, dass sich aufgrund der ausserordentlichen Lage die Verhältnisse in Bezug auf zahlreiche Vertragsbeziehungen verändert haben. Für viele Personen sind grosse finanzielle Einbussen aufgrund laufender Vertragsbeziehungen die Konsequenz.
Gedrängte Darstellung der wesentlichen Voraussetzungen der clausula rebus sic stantibus
Der Ausdruck «clausula rebus sic stantibus» will alle Konstellationen erfassen, bei denen sich aufgrund veränderter Verhältnisse ein Risiko verwirklicht hat. Die clausula ist folglich ein Rechtsinstitut zur Vermeidung von ungerechten Risikoallokationen. Es erlaubt dem Richter, den Vertrag nachträglich abzuändern oder gar aufzuheben.
Eine seit dem Vertragsschluss eingetretene Veränderung der Verhältnisse stellt die Grundvoraussetzung für den Anwendungsbereich der clausula dar. Indem der Bundesrat zahlreiche Massnahmen beschloss, haben sich die Verhältnisse in Bezug auf Verträge, welche vor den konkreten Massnahmen geschlossen wurden, von diesen tangiert werden, deren Erfüllung in den jeweiligen Massnahmezeitraum fallen und die Interessenlage der Parteien berührt, wesentlich verändert.
Eine Vertragspartei kann sich nicht auf Verhältnisveränderungen berufen, um eine Anpassung des Vertrages durch das Gericht zu verlangen, welche im Zeitpunkt des Vertragsschlusses voraussehbar waren. Laut Bundesgericht kommt es auf die objektive Vorhersehbarkeit an. In einem neueren Entscheid relativierte das Bundesgericht die ansonsten sehr restriktive Auslegung der Vorhersehbarkeit etwas, indem es festhielt, dass bei Baurechtsverträgen die Auszonung der Baurechtsgrundstücke generell voraussehbar ist. Haben jedoch zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinerlei Indizien für eine Auszonung bestanden, ist diese zwar generell voraussehbare Veränderung aufgrund von Art und Umfang als unvorhersehbar zu qualifizieren und der Vertrag entsprechend anzupassen (BGer, 22. November 2010, 4A_375/2010, E. 3.1). Das Entstehen von Epidemien an sich ist klar als vorhersehbar zu qualifizieren, da solche bereits hinsichtlich SARS, Ebola- und Zika-Fieber allgemein bekannt sind. Zu diskutieren gilt es, ob die vom Bundesrat mittels der COVID-VO und COVID-2-VO beschlossenen Massnahmen vorhersehbar waren. Die Gesetzgebungskompetenz für diese neu geschaffenen Verordnungen des Bundesrates fliesst aus Art. 6 ff. EpG, welche am 28. September 2012 in Kraft getreten sind. Gesetzesänderungen sind per se vorhersehbar. Haben jedoch zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinerlei Indizien für die in den Notverordnungen getroffenen Massnahmen bestanden, ist diese zwar generell voraussehbare Veränderung aufgrund deren Art und Umfang nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als unvorhersehbar zu qualifizieren und der Vertrag entsprechend anzupassen. Es ist zu konkretisieren, ab wann Indizien für den Erlass von Massnahmen gestützt auf Art. 6 ff. EpG bestanden haben. Da die eigentlich sehr restriktive Voraussetzung der Vorhersehbarkeit hinsichtlich Änderung der Rechtslage vom Bundesgericht gelockert wurde, gilt es bei der Beurteilung, ab wann Indizien bezüglich der in Frage stehenden Änderung der Rechtslage bestanden haben, grosse Strenge walten zu lassen. Die ersten bekannten Erkrankungen aufgrund des COVID-19-Virus sind seit Ende Dezember 2019 bekannt und das Virus breitete sich bis Januar 2020 als Epidemie in Wuhan aus. Somit bestanden ab dem Zeitraum von Ende Dezember 2019 und Januar 2020 Indizien dafür, dass auch hierzulande eine Epidemie entstehen und folglich Massnahmen nach Art. 6 ff. EpG beschlossen werden könnten. Als Stichtag des Bestehens von Indizien sollte der 31. Dezember 2019 fixiert werden. Verträge, die nach dem 31. Dezember 2019 geschlossen wurden, fallen folglich nicht mehr unter den Anwendungsbereich der clausula, da ab dann Rechtsänderungen, wie die vom Bundesrat erlassenen Verordnungen, vorhersehbar waren.
Zuletzt muss die Fortführung des Vertrages für mindestens eine Vertragspartei unzumutbar geworden sein, wie dies bei einer gravierenden Äquivalenzstörung des Synallagmas der Fall ist. Bei Einmalschuldverträgen dürfte regelmässig gerade keine gravierende Äquivalenzstörung vorliegen, da sich der objektive Wert der Sache, welcher sich aus Angebot und Nachfrage ergibt, in den meisten Fällen nicht betroffen sein wird. Dabei ist lediglich der (subjektive) Verwendungszweck einer Partei beeinträchtigt, was jedoch keine Störung des Synallagmas bewirkt. Problematisch ist die Beurteilung einer gravierenden Äquivalenzstörung auch hinsichtlich Dauerschuldverträgen: Es wird oft nur zu einem zwischenzeitlich gravierenden Ungleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung kommen. Dieses zwischenzeitlich gravierende Ungleichgewicht gilt es mit dem Zeitraum, in welchem es kein Ungleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung gibt, in Relation zu setzen. Vorstellbar wäre, dass man bei einem befristeten Dauerschuldverhältnis zum Ergebnis kommt, dass eine gravierende Äquivalenzstörung dann vorliegt, wenn in mehr als 50 Prozent der vereinbarten Laufzeit ein gravierendes Ungleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung bestand. Bei unbefristeten Dauerschuldverhältnissen kann diese 50-Prozent-Grenze jedoch zu stossenden Ergebnissen führen, weshalb bei diesen jeweils eine konkrete Einzelfallbeurteilung erfolgen muss.