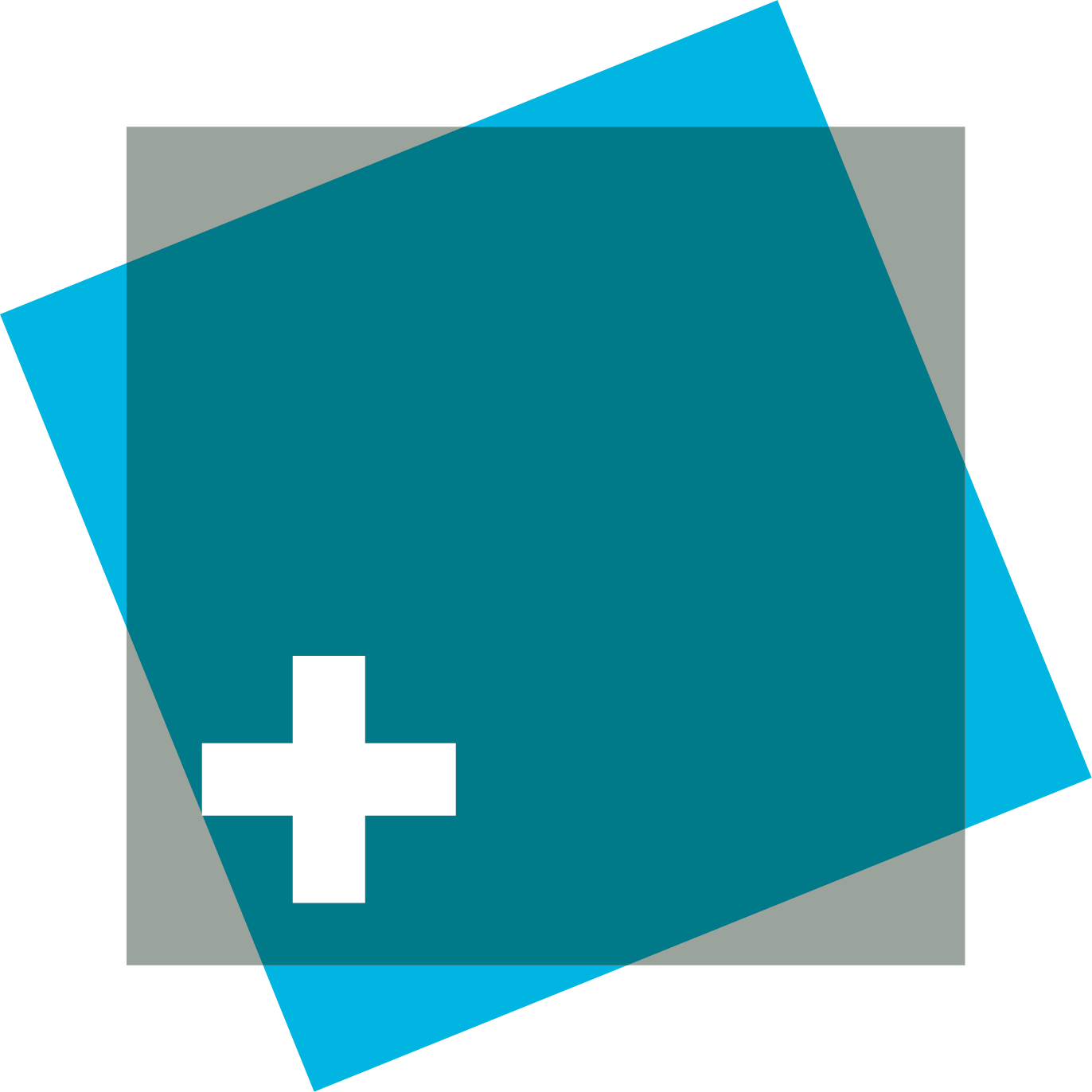Warum sind wir ständig auf Achse?
Annette Rath
Christian Fichter hat sich als Sozial- und Wirtschaftspsychologe eingehend mit unserem Mobilitätsverhalten auseinandergesetzt. Im Gespräch mit den Salzburger Nachrichten erläutert der Forschungsleiter der Kalaidos Fachhochschule in Zürich, welche unbewussten Motive hinter dem Mobilitätsdrang stecken und wie rationales Mobilitätsverhalten bewirkt und zur Not erzwungen werden kann.
Warum setzen wir uns am Ende bevorzugt ins Auto, obwohl wir wissen, dass eine andere Mobilität nachhaltiger und klimafreundlicher wäre?
Fichter: Psychologisch gesehen sind die Motive, die uns zum Handeln bewegen, sehr zentral für unsere Entscheidungen. Es gibt biologische Motive wie Sicherheit, Nahrung, Klima und Fortpflanzung. Und es gibt psychologische Motive wie Freude an Bewegung, Exploration, Bindung und Status, konkret etwa die Leistungsmotivation oder die Motivation, sozialen Anschluss zu finden.
Für unser Mobilitätsverhalten sind diese Motive viel entscheidender als die Vernunft. Wir müssen daher zur Kenntnis
nehmen, dass der Homo mobilis sich meist nicht rational verhält. Die Folge sind irrationale Verkehrsmittelwahl, Staus und volle Züge, Raserei, Aggressivität und Unfälle. Das ist durchaus vergleichbar mit dem Homo oeconomicus, von dem wir auch immer geglaubt haben, dass er der Rationalität folge. De facto aber hat irrationales Verhalten zu Börsencrashs, faulen Hypotheken, Bankenkrisen und Währungskrisen geführt.
Am meisten in Bewegung sind die Pendler. Sie haben ein starkes Motiv: die Arbeit. Wie glücklich oder unglücklich macht das tägliche Pendeln?
Ob Berufstätige mit ihrem Leben zufrieden sind oder nicht, hängt nur wenig vom Pendeln ab. Viel wichtiger sind Familie, Freunde, Gesundheit oder ein sinnvoller Job. Es gibt aber drei konkrete Faktoren, die das Pendeln unangenehm machen: ungeplante Verzögerungen, Gedränge und zu weite Wege. Bevorzugt wird das Verkehrsmittel, mit dem am meisten Zeit gespart wird.
Warum treibt es uns denn, abgesehen vom Pendeln zur Arbeit, überhaupt ständig hinaus? Warum sind wir so unheimlich viel unterwegs?
Die äusseren Anlässe sind sozusagen die Nahursachen: Ich habe einen Termin, und deshalb muss ich los, ich will einkaufen, und deshalb muss ich los. Aber hinter diesen Nahursachen liegen tiefere Funktionen.
Eine solche Funktion der Mobilität ist die, dass es höher entwickelten Lebewesen – insbesondere also Säugetieren – von der Natur oder von der Gesellschaft zur Aufgabe gemacht wurde, die Welt zu erkunden, sich die Welt zu erschliessen. Schon die Amöbe und ihre Vorgänger haben gemerkt, ich befinde mich an einem Ort, an dem es keine Nährstoffe für mich gibt, und ich muss daher woandershin. Die Evolution gab der Amöbe daher Ausstülpungen, mit denen sie sich fortbewegen konnte. Im Prinzip funktionieren die Menschen heute genau gleich. Wir sind beweglich, wir sind mobil. Einerseits kurzfristig. Wenn ich mich zum Beispiel in der Stadt an einem Ort aufhalte, an dem es unangenehme Einflüsse wie Lärm, Staub und Ähnliches gibt, dann setze ich mich ins Auto oder in die Strassenbahn und fahre weg. Dasselbe erleben wir auf globaler Ebene. Wenn es den Menschen an ihrem Ort nicht passt, weil sie keine Arbeit haben, oder schlimmer: weil sie keine Nahrung haben oder es dort Krieg gibt, dann werden sie mobil und fangen an zu wandern, zu migrieren.
Ist sich bewegen demnach ein Überlebensprinzip?
Der Philosoph Blaise Pascal hat schon im 17. Jahrhundert gesagt, alles Unglück der Menschen komme daher, dass sie nicht in der Lage seien, ruhig in ihrem Zimmer zu bleiben. Das stimmt, wir sind dazu nicht in der Lage. Aber das hat seinen guten Grund. Denn wenn wir es täten, würden wir im Status quo verharren, an Ort und Stelle, die Nahrung wäre dann irgendwann erschöpft, das Klima würde sich an diesem Ort vielleicht nachteilig entwickeln, ich würde dort vielleicht keinen Partner, keine Partnerin finden, um Nachkommen zu zeugen, und so fort. Wir könnten uns, auf einen Nenner gebracht, die Welt nicht erschliessen. Es liegt daher in der Natur des Menschen, dass er sich bewegt.
Das ist uns freilich alles nicht bewusst, wenn wir ins Auto steigen.
Nein, weil dahinter die starken, von der Natur angelegten Motive stecken. Schon das Baby hat diese Lust, sich zu bewegen. Wenn ein Kleinkind, das soeben laufen gelernt hat, in einem Spielwarengeschäft diese Bobby-Cars und Tretroller sieht, dann setzt es sich drauf und versucht loszufahren. Genauso kann man das – wenn ich hier in Zürich aus dem Bürofenster schaue – bei jungen Männern zwischen 20 und 30 mit ihren schnittigen Sportwagen beobachten. Sie haben Lust an der Bewegung und auch am Lärm. Da steigt der Testosteronspiegel. Darüber kann man lachen, oder man kann sich aufregen – und man muss es selbstverständlich auch sanktionieren, bevor es gesellschaftsschädigend wird –, aber man muss verstehen, dass dieses Verhalten seine tieferen Motive hat. Es ist das Bedürfnis, sich zu bewegen und dabei auch die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts zu bekommen – siehe Motiv Fortpflanzung!
Sind diese inneren Antriebe der Grund dafür, dass wir uns in der Art unserer Mobilität so ungern dreinreden lassen?
 Es sind zwei Komponenten. Zum einen ist Bewegung ein wichtiges Motiv, und zweitens will ich selbst entscheiden können, wie ich meine Motive verfolge. Wenn beides zusammenkommt, hat man es mit hoher Irrationalität zu tun. Wenn dann die Gemeinschaft oder der Staat sagen, es ist nicht gut, dass wir so viel Auto fahren, fahren wir doch lieber mit dem Zug oder mit der Strassenbahn, dann sehe ich mich in der Freiheit dieser Entscheidung eingeschränkt.
Es sind zwei Komponenten. Zum einen ist Bewegung ein wichtiges Motiv, und zweitens will ich selbst entscheiden können, wie ich meine Motive verfolge. Wenn beides zusammenkommt, hat man es mit hoher Irrationalität zu tun. Wenn dann die Gemeinschaft oder der Staat sagen, es ist nicht gut, dass wir so viel Auto fahren, fahren wir doch lieber mit dem Zug oder mit der Strassenbahn, dann sehe ich mich in der Freiheit dieser Entscheidung eingeschränkt.
Das ist ein Stück weit ein soziales Dilemma. Nicht nur, was Lärm und Umwelt angeht, sondern auch, was die Sicherheit angeht. SUV sind immer noch mitten in der Stadt sehr beliebt. Das hat auch damit zu tun, dass sich Fahrerinnen und Fahrer damit bei einer möglichen Kollision im Vorteil sehen. Würden alle mit einem Kleinwagen fahren, wären bei einem Zusammenstoss alle gleichberechtigt, was ihre Sicherheit betrifft. Wenn einer einen SUV fährt, ist er bei einer Kollision deutlich im Vorteil.
Das Problem ist das gleiche wie beim Wettrüsten von Atommächten. Es gibt ein gemeinschaftliches Gut, die Umwelt oder die Sicherheit, aber dieses Gut bleibt nur so lange intakt und für alle erhalten, wie alle gleich viel davon nehmen. Wenn nun einer kommt und sagt, von diesem Gut Sicherheit nehme ich mir einen grösseren Kuchen als der andere und kaufe mir daher einen SUV, dann müssen die anderen nachziehen, wenn sie gleich viel Sicherheit wollen.
Dieses soziale Dilemma ist beinahe nicht auflösbar, es sei denn, der Staat kommt und sagt, wenn du mehr von diesem Gut nimmst, musst du auch mehr bezahlen.
Ist Mobilitätsverhalten also nur durch Zwangsmassnahmen zu steuern? Oder welche Faktoren spielen mit?
Es sind meiner Meinung nach drei Dinge. Erstens Einsicht und Erziehung. Darauf kann man am ehesten setzen, wenn es um die konkrete Kaufentscheidung für ein Auto geht. Man kann das derzeit in Deutschland und auch Österreich beobachten. Dort hat die Diskussion über Dieselabgase und mögliche Fahrverbote dazu geführt, dass der
Anteil der Dieselfahrzeuge bei den Neuanschaffungen deutlich zurückgegangen ist.
Das Zweite sind soziale Normen, die in die Richtung gehen, dass der Einzelne das Gefühl bekommt, es ist normal, dass ich ein umweltfreundliches Auto fahre und nicht ein besonders umweltschädliches. Mein Ansehen und mein Status steigen, wenn ich ein Hybrid- oder Elektroauto fahre. Andernfalls muss ich damit rechnen, dass ich schief angeschaut werde. Wenn es gelingt, einen gesellschaftlichen Druck aufzubauen, dann ist das eine wünschenswerte Lösung.
Gelingt das nicht, ist das Dritte, dass der Staat eingreift. Das kann durch Aufklärungskampagnen geschehen oder durch Nudging, also den Versuch, die Menschen sanft in Richtung des erwünschten Verhaltens zu stupsen, wie es der eben mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Verhaltensökonom Richard Thaler empfiehlt. Wenn das auch nicht reicht, muss man finanzielle oder gesetzgeberische Anreize schaffen. Dann sind für grosse SUV deutlich höhere
Steuern zu bezahlen oder es wird vorgeschrieben, dass Autos mit fünf Sitzen nicht schwerer als 2000 Kilogramm sein dürfen.
Beim Beitrag handelt es sich um eine leicht gekürzte Fassung des im Oktober erschienenen Interviews.